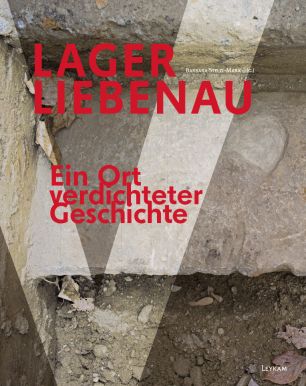Abgeschlossene Projekte der Programmlinie „Weltkriege“
Vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderte Oral History-Projekte. Eine ausgewählte Projektauflistung mit inhaltlichem Fokus auf die NS-Zeit aus Perspektive der Opfer
Ziel ist eine Auflistung der vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderten Projekte, in deren Rahmen Interviews über die Zeit des Nationalsozialismus mit vom Regime verfolgten Personen geführt wurden. Insgesamt werden mehr als 3.600 Projekte untersucht.
Projektförderung: Zukunftsfonds der Republik Österreich (P23-4989)
Projektverantwortliche: Nadjeschda Stoffers
Projektlaufzeit: Juni 2023 – September 2023
Lager V – Liebenau
Das GrazMuseum wird ab November 2018 eine Ausstellung „Lager V Liebenau – Ort der verdichteten Geschichte“ zum Lager Graz-Liebenau, jenem Lager, das seit Jahren im Fokus der Erinnerungskultur steht, beherbergen. Das größte NS-Zwangsarbeiterlager auf Grazer Stadtgebiet diente im April 1945 als Zwischenstation der Evakuierungsmärsche ungarischer Juden vom „Südostwall“ in Richtung KZ Mauthausen. Die vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung unter der Leitung von Barbara Stelzl-Marx konzipierte Ausstellung wird die Geschichte des Lagers während der NS-Zeit beleuchten, aber auch auf die Aufarbeitung bzw. das Vergessen nach 1945 und den aktuellen Umgang mit diesem sensiblen Areal eingehen.
Am 6. April 2018 findet um 19:30:00 Uhr in der Pfarre Graz-Süd, Anton-Lippe-Platz 1, ein Gedenkkonzert statt. Zuvor besteht die Möglichkeit, das ehemalige Lagerareal zu besichtigen.
Nähere Informationen sind der Website „gedenken-liebenau“ zu entnehmen.
Ausstellung „15. JULI 27“
Der Justizpalastbrand vom 15. Juli 1927 stellt zweifellos eine wichtige Wegmarke in der Geschichte der Ersten Republik dar, aus der eine latent bürgerkriegsartige Situation in Österreich resultierte. Er stellte einen ersten Höhepunkt jener gesellschaftlichen Spaltung dar, die im Bürgerkrieg 1934 ihren Höhepunkt fand. 90 Jahre nach den so genannten Juliunruhen initiierte das Bundesministerium für Inneres eine Ausstellung, die sich kritisch mit den Ereignissen auseinandersetzt.
Im Zentrum steht eine didaktische Vermittlung der komplexen Krisensituation, an deren Ende 89 Tote und mehrere hundert Schwerverletzte standen. Die Ausstellung ist von 31. August 2017 bis 4. Februar 2018 im Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, öffentlich zugänglich. Sie veranschaulicht auf einer Fläche von ca. 120 Quadratmetern mittels reichlich Objekten, Foto- und Filmmaterial die Ursachen, die Ereignisse des 15. und 16. Juli 1927 sowie die Folgen auf. Die Gesamtumsetzung der Ausstellung oblag dem BIK unter Leitung von Prof. Stefan Karner und unter Beteiligung von Dr. Bernhard Bachinger, Dr. Julia Köstenberger und Dr. Katharina Bergmann-Pfleger.
100 Jahre Schloss St. Martin
Ziel des Projektes ist die Erforschung und Aufarbeitung der wechselvollen Geschichte des im Westen von Graz gelegenen Schlosses St. Martin, das als bedeutendstes Volksbildungshaus der Steiermark 2019 sein 100. Jubiläum feiert. Schwerpunkt liegt dabei auf der bis heute in der Forschung weitgehend ausgesparten Phase von 1938 bis 1945.
Im 11. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt, prägte St. Martin als Wirtschaftsschloss des Stiftes Admont lange Zeit die Weinbau- und Landwirtschaftsgeschichte im Grazer Raum. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Schloss zum Zentrum der steirischen Volksbildungsbewegung, die jedoch vom NS-Regime unterbrochen und umfunktionalisiert wurde: Ab 1941 nutzte die NSDAP das Schloss unter dem Namen „Gauschulungsburg Martinshof“ für Parteiveranstaltungen und Parteischulungen. 1943 wurde unter St. Martin ein unterirdischer Bunker errichtet, der u. a. dem Gauleiter als Luftschutzkeller und Geheime Befehlszentrale gedient haben soll. Auch gibt es Hinweise, dass die Deutsche Wehrmacht das Schloss als Reichsverwaltungsgebäude nutzte. Trotz eines dunklen Tarnanstriches zerstörten ab März 1944 insgesamt fünf US-Bombenangriffe den Nordwesttrakt zur Gänze. Nach 1945 folgte eine Wiederaufnahme der Bildungsarbeit in geistlicher Tradition, die im Zuge der modernen Neuausrichtung 2011 erstmalig durchbrochen wurde.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden unter anderem über eine Monographie, die zum 100. Jubiläum 2019 erscheinen wird, publiziert. Gefördert wird das Projekt durch das Land Steiermark, das Bildungshaus St. Martin, die Historische Landeskommission für Steiermark und den Zukunftsfonds der Republik Österreich, der die Aufarbeitung des Forschungsdesiderats „Gauschulungsburg Martinshof – Das steirische Volksbildungshaus Schloss St. Martin in der NS-Zeit“ unterstützt. Die Projektleitung hat PD Dr. Barbara Stelzl-Marx inne, Projektmitarbeiterin ist Dr. Katharina Bergmann-Pfleger.
Online-Berichte zu diesem Projekt (Auswahl):
Blogeintrag auf der Website der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK)
„Haus der Geschichte“ im Museum NÖ
Am 9. September 2017 wurde in St. Pölten feierlich das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich eröffnet.
Von Juli 2014 bis September 2017 zeichnete das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung (BIK) für die wissenschaftlich-inhaltliche Gestaltung des „Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich“ (HGNÖ) verantwortlich. Das BIK organisierte die Arbeit des unter der Leitung von Stefan Karner stehenden rund 90-köpfigen internationalen wissenschaftlichen Fachbeirates, andererseits beteiligt es sich in Kooperation mit dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung aktiv an der konkreten Umsetzung des wissenschaftlichen Konzeptes. Letzteres wurde nach intensiver eineinhalbjähriger Arbeit im November 2015 vom wissenschaftlichen Fachbeirat in Form einer Publikation vorgelegt.
Seit 2014 arbeitete das BIK als Teil eines Umsetzungsteams an der Realisierung einer Dauerausstellung und einer Schwerpunktausstellung, die sich ganz dem Fokus des Hauses folgend einem zentralen zeitgeschichtlichen Thema widmet: der Ersten Republik. Die Umsetzungsgruppe bestehend aus HistorikerInnen, MuseologInnen und KulturvermittlerInnen, aus den Grafikern und Architekten, wird angeführt von Stefan Karner und seinem Stellvertreter Wolfgang Maderthaner, Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Informationen zur Ausstellung können auch diesem Interview mit Stefan Karner entnommen werden.
Pressemeldungen (Auswahl):
- Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“, 12. September 2017
- Bericht im Kulturteil der „Niederösterreichischen Nachrichten“, 12. September 2017
- Bericht in den ORF-„Seitenblicken“ (ORF-TVthek), 11. September 2017 (nicht mehr verfügbar)
- Bericht auf noe.orf.at, 10. September 2017
- Bericht auf orf.at, 10. September 2017
- Bericht auf Ökonews.at, 10. September 2017
- Bericht im Online-Reiseführer „askEnrico“, 10. September 2017
- Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“, 9. September 2017
- Bericht in der Online-Ausgabe des „Standard“, 9. September 2017
- Bericht in den „Salzburger Nachrichten“, 9. September 2017
- APA/OTS Aussendung zur Eröffnung des Hauses der Geschichte, 9. September 2017
- Bericht in der „Kleinen Zeitung“, 8. September 2017
- Kommentar in der „Kleinen Zeitung“, 8. September 2017
- Bericht in der „Kleinen Zeitung“, 7. September 2017
- APA Science-Aussendung zum Haus der Geschichte, 7. September 2017
- Kommentar in der Online-Ausgabe des „Standard“, 5. September 2017
- Bericht im „Kurier“, 5. September 2017
- Beitrag im „Kulturmontag“ des ORF vom 4. September 2017 (nicht mehr verfügbar)
- Beitrag im „Österreich-Bild“ des ORF vom 3. September 2017 (nicht mehr verfügbar)
Schweres Erbe und Wiedergutmachung
Das Projekt thematisiert die Bemühungen der Regierung Schüssel zur „Entschädigung“ von NS-Opfern: Genese und Einrichtung des Versöhnungsfonds und des Allgemeinen Entschädigungsfonds. Auf der Basis neu zugänglicher Aktenbestände bettet eine Studie die Ereignisse und Maßnahmen in eine zeitlich wie auch geographisch breiteren Kontext ein.
Thematisiert wurden Entschädigung und Restitution in Österreich seit 1945, „Wiedergutmachung“ in Deutschland und der Schweiz sowie die Rezeption der Restitutions- und Entschädigungsmaßnahmen der Schüssel-Regierung im In- und Ausland. Als institutionelle Säulen wurden Allgemeiner Entschädigungsfonds, Versöhnungsfonds und Zukunftsfonds behandelt. Auch ZeitzeugInnen, die aktiv an den Verhandlungen teilnahmen bzw. diesen aus nächster beiwohnten, waren in das Projekt eingebunden.
Die Projektergebnisse wurden 2015 in einem Sammelband publiziert.
Beyond the Trenches
Im September 2011 startete ein vom Fonds für Wissenschaft und Forschung finanziertes und von Wolfram Dornik geleitetes, dreijähriges Forschungsprojekt. Er befasste sich darin gemeinsam mit einem internationalen Projektteam mit den Kriegserfahrungen österreichisch-ungarischer Soldaten und Offizieren an der Ostfront im Vergleich zu anderen Fronten des Ersten Weltkrieges. Dabei wurden besonders schriftliche Erinnerungen von Kriegsteilnehmern (veröffentlicht wie auch unveröffentlicht) analysiert, aber etwa auch privates wie auch offiziell erstelltes Foto- und Filmmaterial untersucht.
Im März 2012 fand am DHI Warschau der Auftakt-Workshop mit einem Großteil der teilnehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler statt. Dabei wurden insbesondere die beiden Publikationen (Sammelband und Sammelmonografie) zwischen den Autoren akkordiert. Es wurden auch noch dringend zu behandelnde Themen diskutiert, und im Anschluss daran Autoren dazu gesucht. Insbesondere die russische Perspektive wurde durch Evgenij Sergeev und Elena Senjavskajy ergänzt. Der Sammelband wurde Ende des Jahres 2013 präsentiert.

Leben in und nach der Zwangsarbeit
Nach Abschluss des ersten Forschungsprojektes zu den Akten des „Österreichischen Versöhnungsfonds“ Mitte 2013 verfolgt dieses, vom Zukunftsfonds der Republik Österreich unterstützte Folgeprojekt „Leben in und nach der Zwangsarbeit“ seit Juli 2013 die Forschungen zu ausländischen Zwangsarbeitern in Österreich während des Zweiten Weltkrieges weiter. Es setzt die Auswertung des Aktenbestandes des ÖVF nach denselben Zielsetzungen fort, die auch das erste Projekt verfolgte: Anhand der im ÖVF dokumentierten Schicksale Einblick zu geben in die Biografien in Österreich eingesetzter ziviler Zwangsarbeiter, sowohl ihren Arbeitseinsatz während des Zweiten Weltkrieges betreffend als auch über ihr Schicksal über das Kriegende 1945 hinaus.
Die Forschungen des Projektes werden sich in erster Linie auf die aus Polen stammenden zivilen Zwangsarbeiter konzentrieren.
Das Lager Graz-Liebenau in der NS-Zeit
Dieses Projekt hatte einen bislang kaum behandelten Teilaspekt der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Stadt Graz im Fokus: Die Entwicklung und Geschehnisse während des Zweiten Weltkrieges (insbesondere in den letzten Kriegsmonaten) im Lager Liebenau sowie die Nachforschungen durch die britische Besatzungsmacht nach 1945 zu diesen Verbrechen der letzten Kriegswochen.
Das Lager Graz-Liebenau war im April 1945 eine Zwischenstation der ungarischen Juden auf ihren Todesmärschen vom „Südostwall“ in Richtung KZ Mauthausen. Dutzende von ihnen überlebten den Aufenthalt in Graz-Liebenau nicht: Auf Befehl der Lagerleitung mussten die völlig geschwächten jüdischen Zwangsarbeiter im Freien nächtigen, erhielten gänzlich unzureichende Verpflegung und wurden medizinisch nicht mehr versorgt. Mindestens 35 wurden hier erschossen und in Massengräbern verscharrt.
Im Mai 1947 ließ die britische Besatzungsmacht Exhumierungen auf dem ehemaligen Lagerareal durchführen. Im selben Jahr wurde das NS-Verbrechen im Lager Liebenau durch ein britisches Militärgericht untersucht. Auf Basis von Archivdokumenten und zeitgenössischen Medienberichten wurden für die Studie die Grazer NS-Lager, das Schicksal der ungarischen Juden in Liebenau, die Ergebnisse der Exhumierungen und das Gerichtsverfahren mit der begleitenden Berichterstattung erforscht und analysiert. Das von Barbara Stelzl-Marx im Leykam-Verlag publizierte Buch „Das Lager Graz-Liebenau in der NS-Zeit. Zwangsarbeiter – Todesmärsche – Nachkriegsjustiz“ wurde im Jänner 2013 an der Universität Graz vorgestellt.
Die Ukraine 1917 bis 1922
Die Ukraine als Schauplatz des Russischen Bürgerkrieges stand im Mittelpunkt dieses im Juli 2009 gestarteten FWF-Projektes. Forscher aus der Ukraine, Russland, Deutschland, Großbritannien, Polen und Österreich beleuchteten unter Leitung von Stefan Karner und der Mitarbeit von Wolfram Dornik im Zeitraum von zwei Jahren die Geschichte der Ukraine zwischen 1917 und 1922 in einem internationalen Kontext.
Dabei wurde nicht nur die Metaebene der Geschichte (Politik, Diplomatie, Wirtschaft) untersucht, sondern auch der Alltag der Menschen und die Wahrnehmung der Besatzer (österreichisch-ungarische und deutsche Truppen 1918, „Weiße“, polnische Truppen etc.), der Bolschewiki, der Regierungen/Regime und der Nationalbewegung durch die ukrainische Bevölkerung. Die beteiligten Wissenschaftler verknüpften erstmals Dokumente aus Moskau, Kiew, Berlin, Wien, London, Paris und Washington mit den neuesten ukrainischen und internationalen Forschungsergebnissen.
Die Abschlusskonferenz des Projektes fand von 15. bis 17. Juni 2011 in Graz statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch die Abschlusspublikation „Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917–1922“ präsentiert. Der Band enthält eine detaillierte politische, diplomatische, wirtschaftliche und militärische Geschichte der ukrainischen Staatsbildungsversuche zwischen 1917 und 1922, sowie im Speziellen der Besatzung der Ukraine durch österreichisch-ungarische und deutsche Truppen im Jahr 1918. 2015 erschien die ukrainische Übersetzung des Bandes.